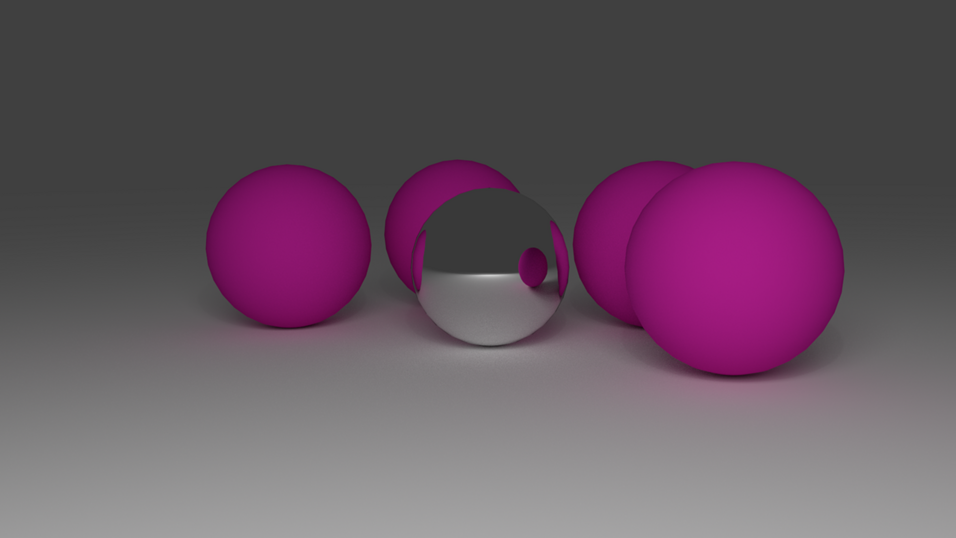Reflexivität wird als rekursive erkenntnistheoretische Arbeit verstanden, die darauf abzielt, implizite Bedingungen und Folgen (a) sozialer Beziehungen und (b) Positionalitäten für die Produktion und Anwendung von Wissen zu erkunden, zu explizieren und kenntlich zu machen. Die Konjunktur des Reflexivitätsbegriffs in der Migrationsforschung kann dabei als eine Reaktion auf eine Krise ehemals etablierter Formen wissenschaftlicher Autorität verstanden werden. Sie wurden insbesondere durch die Kritiken am methodologischen Nationalismus, an ethnisierenden bzw. rassifizierenden Effekten von Differenzdiskursen sowie durch forschungsethische Bedenken hinsichtlich der Machtunterschiede zwischen Forschenden und Erforschten vorangetrieben. Die genauere Betrachtung zeigt aber, dass sich die daran anknüpfenden Reflexivitätsaufforderungen keineswegs in ein einheitliches Paradigma fügen. In dem Vortrag gehe ich dem Gedanken nach, was der Nutzen von reflexiver Arbeit sein kann, wenn sie nicht in der Lage ist, ein neues Paradigma wissenschaftlicher Autorität zu etablieren.
Institut für Soziologie, Seminarraum 3 und online
Zur Vortragsreihe
Zur Einladung